WIR STÄRKEN IHNEN DEN RÜCKEN
In unserem Wirbelsäulenzentrum liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule. Hier stehen Patient*innen alle Leistungen für eine optimale medizinische Versorgung durch unsere Wirbelsäulenspezialist*innen zur Verfügung. Unser Leistungsspektrum erstreckt sich von der Diagnostik, über eine ambulante wie stationäre Behandlung, bis zur Nachbetreuung und Physiotherapie.

Für Terminvereinbarungen
Sanatorium Kettenbrücke
Neurochirurgie und Neurologie
Wirbelsäulenzentrum Innsbruck
Sennstraße 1
6020 Innsbruck
Österreich
Tel. +43 512 2112 700
Fax +43 512 2112 713
E-Mail wik@ sanatorium-kettenbruecke.at
sanatorium-kettenbruecke.at
Unser Leistungsangebot
Auf Basis langjähriger Erfahrung auf den Gebieten der Neurochirurgie und Neurologie legen unsere Fachärzt*innen alle Behandlungsmaßnahmen gemeinsam mit den Patient*innen fest. Wir stehen mit Expert*innen aus aller Welt in Kontakt, um unseren Patient*innen modernste Operationsverfahren und -techniken zu ermöglichen und einen schnellen Heilungsprozess zu erzielen.
Unser Behandlungsspektrum umfasst:
- Bandscheibenvorfälle
- Einengungen des Wirbelkanals
- Wirbelsäuleninstabilitäten
- Verletzungen der Wirbelsäule (Wirbelfrakturen)
- Angeborene und erworbene Abweichungen (Deformitäten) und Fehlbildungen (Skoliose, Kyphose)
- Wirbelgleiten
- Entzündliche Veränderungen
- Veränderungen bei rheumatologischen Erkrankungen
- Tumore der Wirbelsäule und des Nervensystems
- Zementauffüllung der Wirbel bei osteoporotischen Frakturen
- Schmerztherapie

Ihr Wirbelsäulenzentrum-Team
Dr. Michael Gabl
Dr. Michael Gabl ist seit 2005 Vorstandsmitglied der AO Spine Austria „education neurosurgery“. Von 2006 bis 2008 war er leitender Oberarzt in der Universitätsklinik für Neurochirurgie Innsbruck. Als Facharzt zum Sonderfach Neurochirurgie und Additivfacharzt für Intensivmedizin verfügt er über eine langjährige Erfahrung im Bereich der Neurochirurgie.
- Prognostische Faktoren bei KH Blutung und Infarkt
- M Gabl, I Mohsenipour, E Schmutzhard, K Twerdy
- Jahrestagung ÖGNC Wien 1999
- ASDH in the elderly, prognostic factors and Outcome
Gabl M, Galiano K, Bauer R, Koller M, Obwegeser A, Twerdy K
Jahrestagung DGNC Saarbrücken 2003 - State of the Art in der Behandlung schwerer Schädelhirntraumen
Gabl M, Obwegeser A, Bauer R, Galiano K, Anton JV, Mohsenipour I.
Jahrestagung ÖGNC Innsbruck 2002 - State of the Art in der Behandlung schwerer Schädelhirntraumen
Gabl M, Obwegeser A, Bauer R, Galiano K, Anton JV, Mohsenipour I.
AO Symposium der ÖGU Salzburg 2003 - Erkrankungen der Wirbelsäule; Indikation zur operativen Intervention
M.Gabl, M. Koller, K. Galiano, K.Twerdy
Sportmedizinische Tagung Gugl Meeting Linz Juni 2003 - Intraoperative Computed Tomography - Preliminary Experience in Spinal Neurosurgery
JV Anton, M Koller, M Gabl, T Fiegele, J Langmayr and K Twerdy
EANS Lissabon September 2003 - Telefix System; Anterior instrumentation in thoracolumbar spine
M.Gabl, M.Koller
AO Spine Symposium Davos 2004 - Surgical Management of Spinal Neurinomas, dumbbell - type / hourglass Neurinomas
M. Gabl, M. Koller
ANCO Tagung Vigaun 2005 - Neurochirurgische Therapiekonzepte bei radikulären Schmerzen
M. Gabl, M. Koller
Österreichischer Schmerzkongress Innsbruck 2005 - Chirurgisches Management bei cervicalen Myelopathien
M Koller, M Gabl
Gmundner Wirbelsäulensymposium Juni 2005-07-05 - Chirurgisches Management bei lumbalen Kanalstenosen
M Koller, M Gabl
Gmundner Wirbelsäulensymposium Juni 2005-07-05 - PLIVIOS Chronos Workshop / Usermeeting
M Gabl, M Koller EANS Barcelona September 2005 - SYNCAGE LR Chronos Workshop / Usermeeting
M Koller, M Gabl EANS Barcelona September 2005 - Revisionschirurgie + Instrumentierung bei failed back Patienten
Prospektive Evaluierung von Outcome + Lebensqualität
M. Gabl, M. Koller, A. Obwegeser, A. Örley,
V. Dollinger, K. Galiano, C. Plangger, K. Twerdy
ÖGNC Jahrestagung Feldkirch Oktober 2005 - Surgical Management of spinal dumbbell - type / hourglass Neurinomas
M.Gabl, M.Koller, A.Örley, A.Obwegeser, K.Galiano, K.Twerdy;
ÖGNC Jahrestagung Feldkirch Oktober 2005 - PRODISC C Workshop
M. Gabl, M. Koller
ÖGNC Jahrestagung Feldkirch Oktober 2005 - PRODISC L Workshop
M. Koller, M. Gabl
ÖGNC Jahrestagung Feldkirch Oktober 2005 - Bandscheibenchirurgie
Scherzakademie, Österreichische Gesellschaft für Neurologie
Salzburg, Jänner 2006 - Notfall nach/während WS Operationen
ÖGNC Jahrestagung
St. Pölten Oktober 2006 - Anteriore und anterolaterale Chirurgie der LWS
ÖGNC Jahrestagung
St. Pölten Oktober 2006 - Plivios Chronos Cages, clinical experience
Eurospine, European Spine Society
Istambul, Oktober 2006 - Bandscheibenchirurgie
Scherzakademie, Österreichische Gesellschaft für Neurologie
Salzburg, Jänner 2007 - State of the Art in der Behandlung schwerer SHT
Neurotrauma Meeting ÖGNC
Bad Ausee März 2007 - WS Revisionschirurgie
Gmundner WS Symposium
Gmunden, Juni 2007 - Chirurgische Strategie und Zugangsplanung bei komplexen Tumoren der thoracolumbalen Wirbelsäule
AO anterior spine surgery course
Innsbruck, September 2007 - Degenerative LWS Erkrankungen
Sportärztetagung ÖAK
Going, November 2007 - Lumbar Spinal Stenoses, Decompression Techniques
AO Future Seminar
Wien, November 2007 - Instability and Deformity of the cervical spine in NF1
European Association of Neurosurgical Societies
EANS spine training
Opatija, Dezember 2007 - Primary bone tumors of the cervical spine
European Association of Neurosurgical Societies
EANS spine training
Opatija, Dezember 2007 - Biopsing the cervical spine
European Association of Neurosurgical Societies
EANS spine training
Opatija, Dezember 2007 - XLIF / anterolateral approach to the lumbar spine
M. Gabl, M. Koller
AO World Spine Week Davos, Dezember 2007 - Bandscheibenchirurgie
Scherzakademie, Österreichische Gesellschaft für Neurologie
Salzburg, Jänner 2008 - Diagnostik der cervicalen Myelopathie
Österr. Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie, Jahrestagung
Wien, Jänner 2008 - Frakturen der oberen HWS und des Kraniocervicalen Überganges
Neurotrauma Meeting ÖGNC
Bad Aussee März 2007 - Treatment of primary bone tumors of the spine
BG Klinikum Murnau
Murnau, April 2008 - Management of spine tumors
1st Georgien International Neurooncological Meeting
Tiblisi; Mai 2008 - Cervical spine arthroplasty
1st Georgien International Neurooncological Meeting
Tiblisi; Mai 2008 - Discogenic low back pain, Arthroplasty vs. stand alone anterior fusion
1st Georgien International Neurooncological Meeting
Tiblisi; Mai 2008 - Chirurgisches Management von Pathologien im craniocervicalen Übergang
Gmundner WS Symposium
Gmunden, Juni 2008 - AOSpine Anterior Spine surgery Course Innsbruck
Chairperson
Strategy in complex tumor surgery - Anterior approach to the cervicothoracic junction
September 2008 Innsbruck - Vertebral body stenting and zement augmentation Course
PMU Salzburg , Chairperson
Oktober 2008 - Posterior spinal instrumentation „Synapse"
Workshop Chairperson
Jahrestagung ÖGNC Oktober 2008 - Management of Implantfailure in spine surgery
Österr. Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie, Jahrestagung
Wien, Jänner 2009 - Vertebral Body stenting in spine fractures
Workshop Austrian spine society
Chairperson
Wien, Jänner 2009 - Vertebral body stenting and zement augmentation Course
PMU Salzburg , Chairperson
Salzburg, February 2009 - Österr. Konsensusmeeting Chrirugie der Halswirbelsäule
Chairperson
Seefeld März 2009 - Synfix ALIF Surgery Course
Indications for anterior spine surgery
Trainer / Cadaverworkshop
Innsbruck May 2009 - Synfix ALIF Surgery Course
XLIF / ALPA Approach
Trainer / Cadaverworkshop
Innsbruck May 2009 - Interactive Case Discussions „complex spine surgery"
Gmundner WS Symposium
Gmunden, Juni 2009 - Traumatologie der oberen HWS
Gmundner WS Symposium
Gmunden, Juni 2009 - AOSpine Anterior Spine surgery Course Innsbruck
Chairperson
Strategy in complex tumor surgery
Anterior approach to the cervicothoracic junction
September 2009 Innsbruck - Synfix ALIF Surgery Course
XLIF / ALPA Approach
Trainer / Cadaverworkshop
Innsbruck November 2009 - Synfix ALIF Surgery Course
Indications for anterior spine surgery
Trainer / Cadaverworkshop
Innsbruck November 2009 - WS Chirurgie bei chronischen Schmerzpatienten
Tiroler Schmerztage
Innsbruck, November 2009 - Vertebral body stenting and zement augmentation Course
PMU Salzburg, Chairperson
Salzburg, October 2009 - Anterior cervical spine surgery course
Chairperson
Nairoby Kenya, November 2009 - Das sagittale Profil der Halswirbelsäule
Österr. Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie, Jahrestagung
Wien, Jänner 2010 - Vertebral body stenting and zement augmentation Course
PMU Salzburg, Chairperson
Salzburg, February 2010 - Österr. Konsensusmeeting Chirurgie der Lendenwirbelsäule
Chairperson
Seefeld März 2010 - Synfix ALIF Surgery Course
Indications for anterior spine surgery
Trainer / Cadaverworkshop
Innsbruck April 2010 - Synfix ALIF Surgery Course
Surgical approach and technique ALIF L3 - S1
Trainer / Cadaverworkshop
Innsbruck April 2010 - Management of Cervical Myelopathy
Gmundner WS Symposium
Gmunden, Juni 2010 - Lateral lumbar interbody fusion
Surgical approach and surgical technique
Oberdorf Basel , Juni 2010
- Severe kyphoscoliosis after primary Echinococcus granulosus infection of the spine
M. Thaler, M. Gabl, R. Lechner, M. Gstöttner, Ch. Bach
European spine Journal; DOI 10.1007/s00586-010-1398-6, June 2010 - R. Rotter; H. Martin; S. Fürderer; M. Gabl;P. Heini;Th. Mittlmeier
Biomechanische Untersuchung eines neuen minimalinvasiven Verfahrens zur Reposition und Augmentation von osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen mittels Stent
Proceedings des Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 22.-25.10.2008 Berlin; PO10-407 2008; S: 407-407 - S.Fürderer; R.Rotter; M.Gabl; T.Mittlmeier; H.Martin; P.Heini
Biomechanischer in vitro Vergleich eines Stent-basierten Systems versus Ballonkyphoplastie zur Aufrichtung von Wirbelkompressionsfrakturen
European Spine Journal;17(2008); S: 2023-2023 - Intraoccular pressure during lumbar disc surgery in the knee - ellbow position
W Tiefenthaler, M Gabl, B Teuchner, A Benzer
Anesthesiology 2005, Accepted May 2005 - Long term outcome of laminectomy for spinal stenosis in octogenarians Galiano K, Obwegeser AA, Gabl MV, Bauer R, Twerdy K. Spine. 2005 Feb1;30(3):332-5
- Neurochemical monitoring using intracerebral microdialysis during cardiac resuscitation
Bauer R, Gabl M, Obwegeser A, Galiano K, Barbach J, Mohsenipour I.
Intensive Care Med. 2004;30(1):159-61.Epub 2003 - Leitlinien zur Versorgung schwerer Schädelhirntraumen
The Brain Trauma Foundation
The American Association of Neurological Surgeons
The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care
Bearbeitung und Übersetzung sowie Herausgabe deutschsprachige Ausgabe
Arbeitsgruppe Bratislawa Oktober 2002 - Quality of life in patients after meningioma resection
Mohsenipour I, Deusch E, Gabl M, Hofer M, Twerdy K.
Acta Neurochir (Wien). 2001;143(6):547-53 - Suboccipital decompressive surgery in cerebellar infarction
Mohsenipour I, Gabl M, Schmutzhard E, Twerdy K
Zentralbl Neurochir. 1999;60(2)68-73
Dr. Michael Koller
Dr. Michael Koller ist seit 1995 Facharzt für Neurochirurgie und war von 2000 bis 2008 Facharzt und Oberarzt an der Universitätsklinik für Neurochirurgie Innsbruck. Er ist ein häufig gebuchter Fachvortragender zum Thema Neurochirurgie bei Kongressen, Organisationen und Fortbildungsveranstaltungen.
Teilnahme an Operationskursen:
- Instructor Prodisc L Kurs 2006, Wien
- Spinal Tumour Surgery 2005, London
- Prodisc C 2004, Straubing
- Reconstructive Surgery 2004, Nottingham
- Perkutane Nukleotomie 2004, Wien
- Balloon Kyphoplasty 2004, Leiden
- Neuronavigation Brain LAB 2003, München
- Prodisc L 2002, Straubing
- Ventrale Zugänge LWS/BWS 2002, Halle
- AO-Kurs für Wirbelsäulenchirurgie 2000, Davos
- Operationskurs hintere Schädelgrube 2000, Mainz
- Operationskurs „Traumatologie der Wirbelsäule" 2000, Innsbruck
- Wirbelsäulenkurs 1999, München
- Operationskurs „Mikrochirurgie in der Halswirbelsäule" 1999, Wien
- Operationskurs vordere Schädelgrube 1999, Mainz
- „Endoskopic Spine Surgery" 1998, Innsbruck
- Mikrochirurgie 1995, Wien
Kongresse und Fortbildungsveranstaltungen
- Neurochirurgischer Workshop 1998: Implantationstechnik von Hirndrucksonden
- Interdisziplinäre Fortbildungsveranstaltung:
Seefeld Tirol April 2004: Modernes Management von cerebralen Aneurysmen und Angiomen - 1. März 2005: Fortbildungsveranstaltung KH Kufstein und Vortrag
- 10. Mai 2005: Fortbildungsveranstaltung für Allgemeinmediziner in Imst + Vortrag
- Juni 2005: 1. Gmundner Wirbelsäulensymposium - Moderation und Vorträge
- Okt. 2005: Workshop Arthroplastie Feldkirch; PDL, PDC
- 28.10.2005: Prodisc User Meeting Innsbruck
- Nov. 2005: Organisation und Moderation "Fortbildungsveranstaltung der Neurochirurgie Innsbruck"
Vorsitze
- Mai 2005: Wiener Live Operationskurs
- Juni 2005: 1. Gmundner Wirbelsäulensymposium
- Okt. 2005: 41. Jahrestagung der Gesellschaft für Neurochirurgie: Halswirbelsäule
- 10./11.03. 2006: AO Symposium Salzburg
- Abstractband Jahrestagung Neurochirurgie 2005 (Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie)
"Sportfähigkeit und Sportverhalten nach lumbaler Diskus-OP"
"Revisionschirurgie und Instrumentierung bei Failed - Back-Patienten"
"Langzeitergebnisse von introperativer, intrathekaler Schmerzreduktion nach lumbaler Diskushernien-Op: eine doppelblinde, placebokontrollierte, prospektive Studie"
"Erste Erfahrungen mit sonographisch gezielten Infiltrationen an der Lenden- und Halswirbeläule"
"Lebenqualität und Outcome nach lumbaler Stabilisierung"
"Laminektomie mit semirigider Stabilisierung bei älteren Patienten mit multisegmentaler, lumbaler Vertebrostenose assoziiert mit degenerativer Deformität"
"Kann die Lebensqualität von Patienten mit spondylogener Myelopathie durch eine Entlastungslaminektomie verbessert werden?"
"Chirurgisches Management von thorakolumbalen dumbell type Neurinomen" - Mai 2005: SAS New York; Poster "Preliminary outcome with cervical arthroplasty using Bryan Disc Prosthesis"
- Okt. 2005 ÖGN: Poster "Langzeitergebnisse von introperativer, intrathekaler Schmerzreduktion nach lumbaler Diskushernien-Op: eine doppelblinde, placebokontrollierte, prospektive Studie"
- Okt. 2005 ÖGN: Poster "Kann die Lebensqualität von Patienten mit spondylogener Myelopathie durch eine Entlastungslaminektomie verbessert werden?"
- Buchbeitrag
Intraoperative Computed Tomography - Preliminary Experience in Spinal Neurosurgery
JV Anton, M Koller, M Gabl, T Fiegele, J Langmayr and K Twerdy
EANS Lissabon September 2003
Abstractband Jahrestagung Neurochirurgie 2004 (Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie)
"Acute traumatic subdural haematoma in the elderly" - EANS Lissabon September 2003: Cervical Anterior Fusion with Carbon Fiber Cage
- Abstractband DGNC 2002 "Quality of life after laminectomy for lumbar spinal stenosis in advanced age
- Abstractband Jahrestagung Neurochirurgie 2002 (Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie)
"Maverick - Lumbar Disc Prosthesis"
„Neurochirurgische Therapiemöglichkeiten und Konzepte im hohen Alter" - Acta Neurochirurgica 1999
Posterior-Fossa Haemorrhage After Supratentorial Surgery - Report of Three Cases and Review of the Literature - Abstractband der Gesellschaft für Unfallchirurgie 1998
Intraparenchymale Messung des intracraniellen Druckes bei Schädel-Hirn-Trauma - Zentralblatt für Neurochirurgie 1996
Magnetresonanztomographie bei Patienten mit verstellbaren Ventilen vom Sophy-Typ
Dr. Jochen Obernauer
Dr. Jochen Obernauer absolvierte seine Ausbildung zum Facharzt für Neurochirurgie unter Prof. Claus Twerdy und Prof. Claudius Thomé an der Universitätsklinik für Neurochirurgie Innsbruck. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen mit Hauptaugenmerk auf degenerative Wirbelsäulenerkrankungen. Seit April 2016 ist er Mitglied des Wirbelsäulenzentrum-Teams.
- Zervikale Bandscheibenprothetik Lunchsymposium -Deutscher Wirbelsäulenkongress, Leipzig 2014
- Ultrasound Guided Versus CT-Controlled Pararadicular Injections in the Lumbar Spine: A Prospective Randomized Clinical - Trial Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft f. Neurochirurgie, Graz 2012
- Cervical corpectomies: results of a survey and review of the literature on diagnosis, indications, and surgical technique. Hartmann S, Tschugg A, Obernauer J, Neururer S, Petr O, Thomé C. Acta Neurochir (Wien). 2016 Aug 25. [Epub ahead of print]
- Cervical arthroplasty with ROTAIO® cervical disc prosthesis: first clinical and radiographic outcome analysis in a multicenter prospective trial. Obernauer J, Landscheidt J, Hartmann S, Schubert GA, Thomé C, Lumenta C. BMC Musculoskelet Disord. 2016 Jan 12;17(1):11. doi: 10.1186/s12891-016-0880-7. 1,72 Impact Factor
- A Sandwich Technique for Prevention of Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea and Reconstruction of the Sellar Floor after Microsurgical Transsphenoidal Pituitary Surgery Christian F Freyschlag · Stephanie Alice Goerke · Jochen Obernauer · Johannes Kerschbaumer · Claudius Thomé · Marcel Seiz. Journal of Neurological Surgery. Part A. Central European Neurosurgery 06/2015; DOI:10.1055/s-0035-1547357 0.61 Impact Factor
- Pedicle-Based Non-fusion Stabilization Devices: A Critical Review and Appraisal of Current Evidence Jochen Obernauer · Pujan Kavakebi · Sebastian Quirbach · Claudius Thomé. Advances and technical standards in neurosurgery 01/2014; 41:131-42. DOI:10.1007/978-3-319-01830-0_6
- Buchbeitrag: Radikuläre Syndrome Jochen Obernauer · Claudius Thomé Neurochirurgie - Handbuch für die Weiterbildung und interdisziplinäres Nachschlagewerk, 2 edited by Dag Moskopp, Hansdetlef Wassmann, 01/2014; Schattauer GmbH Stuttgart., ISBN: 978-3-7945-2442-6
- Bandscheibenprothesen und Non-Fusion - ein Update Jochen Obernauer · Sebastian Hartmann · Claudius Thomé. Neurochirurgie Scan 11/2013; 2013(1):225-238. DOI:10.1055/s-0033-1358827
- Ultrasound-guided versus computed tomography-controlled periradicular injections in the middle and lower cervical spine: a prospective randomized clinical trial. Jochen Obernauer · Klaus Galiano · Hannes Gruber · Reto Bale · Alois Albert Obwegeser · Reinhold Schatzer · Alexander Loizides. European Spine Journal 07/2013; DOI:10.11152/mu.2013.2066.151.jo1ugc2 2.07 Impact Factor
- Driving reaction time before and after anterior cervical fusion for disc herniation: A preliminary study Ricarda Lechner · Martin Thaler · Martin Krismer · Christian Haid · Jochen Obernauer Alois Obwegeser. European Spine Journal 03/2013; 22(7). DOI:10.1007/s00586-013-2688-6 2.07 Impact Factor
- Ultrasound-guided versus Computed Tomography-controlled facet joint injections in the middle and lower cervical spine: A prospective randomized clinical trial Jochen Obernauer · Klaus Galiano · Hannes Gruber · Reto Bale · Alois Albert Obwegeser · Reinhold Schatzer · Alexander Loizides. Medical ultrasonography 03/2013; 15(1):10-5. DOI:10.1007/s00586- 013-2916-0 1.11 Impact Factor
- Ultrasound-guided Injections in the Spine Alexander Loizides · Jochen Obernauer · Reto Bale · Michaela Plaikner · Klaus Galiano · Hannes Gruber Techniques in Orthopaedics 03/2013; 28(1):6-11. DOI:10.1097/BTO.0b013e318289737e
- Ultrasound-guided injections in the middle and lower cervical spine Alexander Loizides · Jochen Obernauer · Siegfried Peer · Reto Bale · Klaus Galiano · Hannes Gruber . Medical ultrasonography 09/2012; 14(3):235-8. 1.11 Impact Factor
- Ultrasound Guided Versus CT-Controlled Pararadicular Injections in the Lumbar Spine: A Prospective Randomized Clinical Trial A Loizides · H Gruber · S Peer · K Galiano · R Bale · J Obernauer American Journal of Neuroradiology 07/2012; 34(2). DOI:10.3174/ajnr.A3206 3.59 Impact Factor
- What is new? Hannes Gruber · Alexander Loizides · Klaus Galiano · Jochen Obernauer Regional anesthesia and pain medicine 07/2012; 37(4):460; author reply 460-1. DOI:10.1097/AAP.0b013e318253381a 3.09 Impact Factor
- Pararadicular Injections in the Lumbar Spine under Ultrasound Guidance: A Prospective Randomized Clinical Trial Alexander Loizides · Siegfried Peer · Jochen Obernauer · Michaela Plaikner · Tanja Djurdjevic · Hannes Gruber Radiological Society of North America 2011 Scientific Assembly and Annual Meeting; 11/2011
- Ultrasound-Guided Versus Computed Tomography-Controlled Pararadicular Injections in the Lumbar Spine: A Prospective Randomised Clinical Trial A. Loizides · S. Peer · M. Plaikner · J. Obernauer · K. Galiano · H. Gruber Ultrasound in Medicine & Biology 08/2011; 37(8). DOI:10.1016/j.ultrasmedbio.2011.05.338 2.21 Impact Factor
- Ultrasound-Guided Pain Control in the Cervical Spine: A Prospective Randomised Clinical Trial A. Loizides · S. Peer · M. Plaikner · J. Obernauer · K. Galiano · H. Gruber Ultrasound in Medicine & Biology 08/2011; 37(8). DOI:10.1016/j.ultrasmedbio.2011.05.337 2.21 Impact Factor Ultrasound-guided injections in the lumbar spine. Med Ultrason Alexander Loizides · Siegfried Peer · Michaela Plaikner · Verena Spiss · Klaus Galiano · Jochen Obernauer · Hannes Gruber Medical ultrasonography 03/2011; 13(1):54-8. 1.11 Impact Factor
- A New Simplified Sonographic Approach for Pararadicular Injections in the Lumbar Spine: A CT-Controlled Cadaver Study A Loizides · H Gruber · S Peer · E Brenner · K Galiano · J Obernauer American Journal of Neuroradiology 02/2011; 32(5):828-31. DOI:10.3174/ajnr.A2389 3.59 Impact Factor
- Ultraschallgezielte periradikuläre Instillationen an der LWS: eine kontrollierte Machbarkeitsstudie eines neuartigen Zugangs A Loizides · K Galiano · J Obernauer · H Gruber Ultraschall in der Medizin 09/2010; 31(S 01). DOI:10.1055/s-0030-126680 4.92 Impact Factor Publikationsliste Dr. J.W. Obernauer, Stand 08.10.2015 4
- Die Rolle der hochauflösenden Sonografie des erwachsenen Gehirns: Ein neuer neurochirurgischer Ansatz zur optimierten Navigation mittels eines radiologischen Echtzeit-Verfahrens A Loizides · K Galiano · J Obernauer · S Peer · S Ostermann · H Gruber Ultraschall in der Medizin 09/2010; 31(S 01). DOI:10.1055/s-0030-1266808 4.92 Impact Factor
Dr. Pujan Kavakebi
Dr. Pujan Kavakebi absolvierte seine Ausbildung zum Facharzt für Neurochirurgie an der Universitätsklinik für Neurochirurgie Innsbruck. Nach einem Jahr als leitender Oberarzt im LKH Feldkirch war er von 2013 bis 2018 leitender Oberarzt an der Neurochirurgie Innsbruck. Seit 2018 ist Dr. Kavakebi Vorstandsmitglied der AO Spine Austria. In zahlreichen Kursen fungiert er als Trainer für Wirbelsäulenchirurgen.
Trainer / Vorträge in OP-Kursen / Meetings
- Expedium 5.5 User Meeting Frankfurt, GER May 24, 2013
- MIS Instructional Course Barcelona, ES Sep 2-3, 2013
- Navigation Expert Meeting Feldkirchen, GER Jun 26-27, 2014
- Neurosurgical Challenges Brüssel, BE May 10, 2014
- Expedium Viper Days Solothurn, CH May 22-23, 2014
- Cervical Instructional Course Barcelona, ES Sep 4-5, 2014
- Expedium Viper Days Solothurn, CH Sep 11-12, 2014
- Expedium Viper Days Solothurn, CH Nov 13-14, 2014
- Expedium Viper Days Solothurn, CH Feb 5-6, 2015
- Viper One Step VOC Meeting Basel, CH Mar 27, 2015
- Navigation Expert Meeting Feldkirchen, GER Apr 16-17, 2015
- Minimally Invasive special forces - Spine Solothurn CH, May 27-29, 2015
- AOSpine Advanced Level Specimen Course Innsbruck, AUT Sep 10-11, 2015
- Expedium Viper Days Solothurn, CH Sep 17-18, 2015
- MIS Instructional Course Barcelona, ES Nov 3-4, 2015
- Advanced Cervical Instructional Course Barcelona, ES Nov 5-6, 2015
- Expedium Viper Days Solothurn, CH Nov 19-20, 2015
- Spine Symposia at AO Courses Davos, CH Dec15, 2015
- Advanced MIS Summit Miami, USA Jan 15-16, 2016
- Surgery Week Spine Modul Wien, AUT Feb 2, 2016
- Expedium Viper Days Solothurn, CH Feb 4-5, 2016
- MIS Instructional Course Barcelona, ES Mar 15-16, 2016
- MIS Navigation Wet Lab Zuchwil, CH Apr 5-6, 2016
- AOSpine Advanced Level Specimen Course Innsbruck, AUT Sep 8-9, 2016
- Advanced Cervical Instructional Course Barcelona, ES Sep 29-30, 2016
- Eurospine Lunchsymposium Berlin, GER Oct 6, 2016
- Kick 2D Training Event Solothurn, CH Nov 21-23, 2016
- Advanced MIS Summit Miami, USA Jan 20-21, 2017
- Advanced Cervical Instructional Course Hamburg, GER Mar 9-10, 2017
- MIS Advisory Board Solothurn, CH Mar 30-31, 2017
- Polish Masterclass Course MIS Torun, PL Jun 19-20, 2017
- AOSpine Anterior Spine Surgery Course Innsbruck, AUT Sep 7-8, 2017
- MIS Instructional Course Hamburg, GER Sep 12-13, 2017
- Viper Prime Release Surgeons Training Solothurn, CH Sep 14-15, 2017
- Viper Prime NASS Booth Talk Orlando, USA, Oct 26, 2017
- Meet the Experts at AOSpine Symposium Davos, CH Dec 13, 2017
- Motivationstechniken in der medizinischen Ausbildung Salzburg, AUT Jan 26, 2018
- Innovation Experience MIS Solothurn, CH Feb 14-16, 2018
- Advanced Cervical Instructional Course Hamburg, GER Feb 8-9, 2018
- AOSpine Basis Kurs Anthering, AUT Apr 13-14, 2018
- MIS Instructional Course Hamburg, GER Apr 16-17, 2018
- AOSpine Anterior Spine Surgery Course Innsbruck, AUT Sep 10-11, 2018
- Spine Discussion Group Innsbruck, AUT Jan 11-12, 2019
- Advanced Cervical Instructional Course Hamburg, GER Mar 14-15, 2019
- MIS TLIF Training Academy Hamburg, GER May 2-3, 2019
- AOSpine Basis Kurs Anthering, AUT May 23-25, 2019
- AOSpine Anterior Spine Surgery Course Salzburg, AUT Sep 5-6, 2019
- MIS TLIF Training Academy Hamburg, GER Sep 16-17, 2019
- Emerging Technologies for the Complex Spine Madrid, ES Oct 11-13, 2019
- Advanced Cervical Instructional Course Hamburg, GER Oct 21-22, 2019
- Advanced Cervical Instructional Course Hamburg, GER Nov 14-15, 2019
Vorträge Teilnahme
- 42. Jahrestagung der ÖGNC Wien, AUT Oct, 2006
- Advanced Drilling Techniques Lausanne, CH Mar 6-7, 2007
- 58. Jahrestagung der DGNC Leipzig, GER Apr 26-29, 2007
- AOSpine interaktiver Wirbelsäulenkurs für Ärzte Murnau, GER Jul 13-14, 2007
- AOSPine Principles and Treatment of Spinal Disorder Moskau, RUS Oct 25-26, 2007
- 43. Jahrestagung der ÖGNC Salzburg, AUT Nov 9-10, 2007
- LIS-Anwender-Symposium Vogtareuth, GER Feb 21-22, 2008
- AOSpine Course in Degenerative Spine Diseases Frankfurt, GER Apr 18-19, 2008
- 1st Georgian Neuro-Oncological Meeting TBILISI, GEO May 24-25, 2008
- Gmundner Wirbelsäulen Symposium Gmunden, AUT Jun 5-7, 2008
- Expert Vertebroplastie Innsbruck, AUT Aug 21-22, 2008
- AOSpine Anterior Spine Surgery Course Innsbruck, AUT Sep 1-2, 2008
- Spinal Microsurgery München, GER Oct 8-10, 2008
- DePuy Surgery Week Wien, AUT Mar 24-25, 2009
- MIS Techniques for Fusion Treatment Salzburg, AUT Jun 23-24, 2009
- 16th International Meeting on Advanced Spine Techniques Wien, AUT Jul 15-18, 2009
- AOSpine Advances in Anterior Spine Surgery Innsbruck, AUT Sep 17-18, 2009
- AOSpine Live Tissue Training Strassburg, FRA Sep 25-26, 2009
- 4. Deutscher Wirbelsäulenkongress München, GER Dec 10-12, 2009
- Viper 2 Workshop Wien, AUT Jan 19, 2010
- EuroSpine Congress Wien, AUT Sep 15-17, 2010
- 46. Jahrestagung der ÖGNC Bad Erlach, AUT Oct 15-16, 2010
- 5. Deutscher Wirbelsäulenkongress Bremen, GER Dec 16-18, 2010
- Global Spine Congress Barcelona, ES Mar 24-26, 2011
- 9th Hands On Live Surgery Wien, AUT May 26-27, 2011
- 18th International Meeting an Advanced Spine Techniques Kopenhagen, DK Jul 13-16, 2011
- AOSpine Anterior Spine Surgery Innsbruck, AUT Sep 5-6, 2011
- 47. Jahrestagung der ÖGNC Wien, AUT Oct 7-8, 2011
- Neuroseminar Feldkirch, AUT Apr 13-14, 2012
- Synthes Tag für OP-Personal Innsbruck, AUT May 7, 2012
- Kypho-IORT Trainingskurs Salzburg, AUT Jun 20-21, 2012
- Medtronic Summer University Rom, ITA Jun 27-29, 2012
- 3rd Charité Spine Tumor Days Berlin, GER May 31-1, 2013
- Hausärztekongress Innsbruck, AUT Sep 21, 2013
- 49. Jahrestagung der ÖGNC Innsbruck, AUT Oct 10-12, 2013
- Minimal invasive Chirurgie an der LWS Anif, AUT Nov 8, 2013
- Advances MIS Learning Center Barcelona, ES Nov 28-29, 2013
- 50. Jahrestagung der ÖGNC Wien, AUT Oct 9-10, 2014
- 9. Deutscher Wirbelsäulenkongress Leipzig, GER Dec. 11-13, 2014
- 16. Symposium der Österreichischen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie Wien, AUT Jan 31, 2015
- 11. Wirbelsäulensymposium Anif, AUT Jun 11, 2015
- SITONA Wetlab & Workshop Spine Salzburg, AUT Jun 12, 2015
- Advanced Sagittal Alignment & Osteotomy Course Barcelona, ES Jun 24-26, 2015
- 4th Bologna-Budapest Spine Meeting Bologna, ITA Oct 22-24, 2015
- 10. Deutscher Wirbelsäulenkongress Frankfurt, GER Dec 10-12, 2015
- 17. Symposium der Österreichischen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie Wien, AUT Jan 30, 2016
- 11. Deutscher Wirbelsäulenkongress Hannover, GER Dec 1-2, 2016
- DepuySynthes Lunch Symposium Eurospine Dublin, IRL Oct 11, 2017
- Neurotrauma and Spine Surgery Spring Symposium Budapest, HUN Apr 5-6, 2018
- O-Arm Symposium Linz, AUT Sep 27-28, 2018
- 13. Deutscher Wirbelsäulenkongress Frankfurt, GER Nov 6-7, 2018
- 39. SPOT Congress Lissabon, POR Oct 25-26, 2019
- 20. Symposium der Österreichischen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie Wien, AUT Jan 26, 2019
- 21. Symposium der Österreichischen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie Wien, AUT Jan 25, 2020
- Kavakebi P, Freyschlag CF, Thomé C. How I do it-optimizing radiofrequency ablation in spinal metastases using ict and navigation. Acta Neurochir (Wien) 2017, Aug 1.
- Kavakebi P, Girod PP, Hartmann S, Tschugg A, Thomé C. Transoral vertebroplasty of the lateral mass of C1 using image guidance. Acta Neurochir (Wien) 2017, Jun;159(6):1159-62.
- Kavakebi P, Tschugg A, Hartmann S, Lener S, Wipplinger C, Löscher WN, Neururer S, Wildauer M, Thomé C. Clinical and radiological effect of medialized cortical bone trajectory for lumbar pedicle screw fixation in patients with degenerative lumbar spondylolisthesis: study protocol for a randomized controlled trial (mPACT). Trials. 2018 Feb 20;19(1):129.
- Hartmann S, Thomé C, Tschugg A, Paesold J, Kavakebi P, Schmölz W. Cement-augmented screws in a cervical two-level corpectomy with anterior titanium mesh cage reconstruction: A biomechanical study. Eur Spine J 2017, Apr;26(4):1047-57.
- Girod PP, Hartmann S, Kavakebi P, Obernauer J, Verius M, Thomé C. Asymmetric pedicle subtractionosteotomy (apso) guided by a 3d-printed model to correct a combined fixed sagittal and coronal imbalance. Neurosurg Rev 2017, Jul 24.
- Hartmann S, Wipplinger C, Tschugg A, Kavakebi P, Örley A, Girod PP, Thomé C. Thoracic corpectomy for neoplastic vertebral bodies using a navigated lateral extracavitary approach-a single-center consecutive case series: Technique and analysis. Neurosurg Rev 2017, Aug 17.
- Hartmann S, Kavakebi P, Wipplinger C, Tschugg A, Girod PP, Lener S, Thomé C. Retrospective analysis of cervical corpectomies: Implant-related complications of one- and two-level corpectomies in 45 patients. Neurosurg Rev 2017, Apr 17.
- Hartmann S, Tschugg A, Kavakebi P, Thomé C. Intradural synovial cyst of the atlantoaxial joint: A case report. Acta Neurochir (Wien) 2016, Aug;158(8):1583-6.
- Thaler M, Lechner R, Foedinger B, Haid C, Kavakebi P, Galiano K, Obwegeser A. Driving reaction time before and after surgery for disc herniation in patients with preoperative paresis. Spine J 2015, May 1;15(5):918-22.
- Obernauer J, Kavakebi P, Quirbach S, Thomé C. Pedicle-Based non-fusion stabilization devices: A critical review and appraisal of current evidence. Adv Tech Stand Neurosurg 2014;41:131-42.
- Thaler M, Lechner R, Foedinger B, Haid C, Kavakebi P, Galiano K, Obwegeser A. Driving reaction time before and after surgery for lumbar disc herniation in patients with radiculopathy. Eur Spine J 2012, Nov;21(11):2259-64.
- Tiefenthaler W, Pehboeck D, Hammerle E, Kavakebi P, Benzer A. Lung function after total intravenous anaesthesia or balanced anaesthesia with sevoflurane. Br J Anaesth 2011, Feb;106(2):272-6.
- Hohlrieder M, Tiefenthaler W, Klaus H, Gabl M, Kavakebi P, Keller C, Benzer A. Effect of total intravenous anaesthesia and balanced anaesthesia on the frequency of coughing during emergence from the anaesthesia. Br J Anaesth 2007, Oct;99(4):587-91.
- Kavakebi P, Hausott B, Tomasino A, Ingorokva S, Klimaschewski L. The n-end rule ubiquitin-conjugating enzyme, HR6B, is up-regulated by nerve growth factor and required for neurite outgrowth. Mol Cell Neurosci 2005, Aug;29(4):559-68.
- Nindl W, Kavakebi P, Claus P, Grothe C, Pfaller K, Klimaschewski L. Expression of basic fibroblast growth factor isoforms in postmitotic sympathetic neurons: Synthesis, intracellular localization and involvement in karyokinesis. Neuroscience 2004;124(3):561-72.
- Klimaschewski L, Nindl W, Feurle J, Kavakebi P, Kostron H. Basic fibroblast growth factor isoforms promote axonal elongation and branching of adult sensory neurons in vitro. Neuroscience 2004;126(2):347-53.
- Hartmann S, Kavakebi P, Tschugg A, Lener S, Stocsits A, Thomé C. Navigation for Tubular Decompression of the L5 Nerve Root Ganglion after Cement Leakage via a Wiltse Approach. Asian J Neurosurg. 2019
Priv.-Doz. Dr. Sebastian Hartmann, PhD
Priv.-Doz. Dr. Sebastian Hartmann, PhD absolvierte seine Ausbildung an der Universitätsklinik für Neurochirurgie Innsbruck unter Prof. Claudius Thomé. Von 2018 bis 2022 war er dort als leitender Oberarzt tätig. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten und Preisen sowie internationalen Hospitationen ist er Vorstandsmitglied der AO Spine (AOSAT Officer Neurosurgery) und betreut als Vortragender und Ausbilder für Wirbelsäulenchirurgie zahlreiche Kurse und Kongresse.
Kongressvorträge, eingeladene Vorträge, OP-Kurse
- S. Hartmann, M. Thaler, M. Gabl, R. Lechner, CM. Bach: Footprint mismatch in total cervical disc arthroplasty. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Graz, Austria 10/2012
- S. Hartmann, A. A. Hegewald, A. Keiler, K. M. Scheufler, C. Thomé, W. Schmölz: Lumbar Dynamic Stabilization System. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Graz, Austria 10/2012
- S. Hartmann, A. A. Hegewald, A. Keiler, K. M. Scheufler, C. Thomé, W. Schmölz: Lumbar Dynamic Stabilization System. „Deutsche Gesellschaft für Biomechanik“ (DGfB), Poster Session, Ulm, Germany 05/2013
- S. Hartmann, S. Neururer. A. Tschugg, K.M. Scheufler, A.A. Hegewald, C. Thomé: Is it time to go? Prospective evaluation of the “timed up and go test” and the “Visual Analog Scale” in perioperative setting of patients with mono- or bisegmental spondylodesis. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Innsbruck, Austria 10/2013
- S. Hartmann, A. Tschugg, A. Keiler, A. H. Fritsch, A. Hegewald, C. Thomé, W. Schmölz: Biomechanical testing of circumferential instrumentation after multilevel cervical corpectomy and gender-specific aspects of cervical instrumentation. „Österreichische Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin“ (ÖGGSM), Vienna, Austria 03/2014
- S. Hartmann, A. Tschugg, A. Keiler, A. H. Fritsch, A. Hegewald, C. Thomé, W. Schmölz: Biomechanical testing of circumferential instrumentation after multilevel cervical corpectomy. „Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie“ (DGNC- Postersession), Dresden, Germany 05/2014
- S. Hartmann, S. Neururer. A. Tschugg, K.M. Scheufler, A.A. Hegewald, C. Thomé: Is it time to go? Prospective evaluation of the “timed up and go test” and the “Visual Analog Scale” in perioperative setting of patients with mono- or bisegmental spondylodesis. „Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie“ (DGNC), Dresden, Germany 05/2014
- P.-P. Girod, M. Ortler, P. Kavakebi, A. Oerley, S. Hartmann, Claudius Thomé: Clinical and radiological outcome of pedicle subtraction osteotomy (PSO) to correct the sagittal balance in adult deformity. „Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie“ (DGNC), Dresden, Germany 05/2014
- S. Hartmann, S. Neururer, A. Tschugg, M. Abenhardt, AA. Hegewald, C. Thomé: The objectivity of unidimensional pain scales: Relationship of the “performance-based” Timed up and Go-test with the Visual Analog Scale in patients treated with lumbar mono-/ or bisegmental spondylodesis. „Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie“- Sektionstagung Wirbelsäule der DGNC, Innsbruck, Austria 09/2014
- S. Hartmann, AA. Hegewald, A. Keiler, H. Fritsch, C. Thomé, W. Schmölz: Biomechanical evaluation of the cervical spine: 180°- vs. 360° corpectomy constructs to restore the cervical spine. „Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie“- Sektionstagung Wirbelsäule der DGNC, Innsbruck, Austria 09/2014
- S. Hartmann, AA. Hegewald, A. Tschugg, J. Obernauer, H. Fritsch, C. Thomé, W. Schmölz: Circumferential instrumentation after cervical multilevel-corpectomies: A biomechanical investigation. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Vienna, Austria 10/2014
- S. Hartmann, C. Wipplinger, P. Kavakebi, A. Tschugg, J. Obernauer, C. Thomé: Intra- und früh- postoperative Ergebnisse von 72 Patienten nach 1-,2- und 3- Level Korporektomien an der Hals- und Brustwirbelsäule: Ergebnisse einer retrospektiven Datenerhebung in Bezug auf Implantatversagen. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Vienna, Austria 10/2014
- S. Hartmann. Additive dorsale Stabilisierung bei cervicaler multilevel Korporektomie: Biomechanische Grundlagen und Ergebnisse einer Multicenterumfrage. Lunch Symposium AO Spine- „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Vienna, Austria 10/2014
- S. Hartmann, AA. Hegewald, A. Tschugg, J. Obernauer, H. Fritsch, C. Thomé, W. Schmölz: Biomechanische Evaluation einer zirkumferentiellen Instrumentation nach zervikaler Multi- Level- Korporektomie. „Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), Leipzig, Germany 12/2014
- S. Hartmann, S. Neururer, A. Tschugg, M. Abenhardt, AA. Hegewald, C. Thomé: How do we improve the objectivity of unidimensional pain scales? Comparison of the Visual Analog Scale with a “performance-based” functional test in patients treated with lumbar mono- or bisegmental spondylodesis. „Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), Leipzig, Germany 12/2014
- S. Hartmann, C. Thomé, W. Schmölz: Anterior cervical corpectomy and reconstruction: Biomechanical evaluation of anterior-only and circumferential instrumentation of the cervical spine. „Cervical Spine Research Society“ (CSRS), London, UK 05/2015
- S. Hartmann, C. Wipplinger, P. Kavakebi, A. Tschugg, J. Obernauer, C. Thomé: Complications of cervical and thoracic corpectomies: Retrospective outcome analysis of 72 patients. „Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie“ (DGNC), Karlsruhe, Germany 06/2015
- S. Hartmann, A. Tschugg, S. Neururer, J. Obernauer, O. Petr, C. Thomé: Cervical corpectomies: Results of a survey on diagnosis, indications and surgical technique. „Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie“ (DGNC), Karlsruhe, Germany 06/2015
- S. Hartmann, A. Tschugg, S. Neururer, J. Obernauer, O. Petr, C. Thomé: Cervical corpectomies: Results of a survey on diagnosis, indications and surgical technique. „Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), Frankfurt, Germany 12/2015
- S. Hartmann, A. Tschugg, C. Wipplinger, P. Kavakebi, P.P. Girod, C. Thomé: Vergleich von minimal-invasiver und offener lumbaler Spondylodese: Eine prospektiv- kontrollierte Observationsstudie. „Austrian Spine Society” (ASS), Vienna, Austria 01/2016
- P.-P. Girod, P. Kavakebi, A. Oerley, S. Hartmann, C. Thomé: Einfuss des Alters auf perioperative Komplikationen und Outcome von Pedikelsubtraktionsosteotomien (PSO) zur Korrektur der sagittalen Balance in adulten Deformitäten. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie” (ÖGNC), Linz, Austria 10/16
- S. Hartmann, C. Thomé, A. Tschugg, P. Kavakebi, P.P. Girod, A. Örley, W. Schmölz: Cement-augmented screws in a cervical two-level corpectomy with anterior Titanium Mesh Cage reconstruction: a biomechanical study. “Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), Hannover, Germany 12/2016
- S. Hartmann, R. Gmeiner, A. Tschugg, C. Thomé, W. Schmölz, H. Koller: Der Effekt diverser Schrauben-Stab Konfigurationen und multipler Schrauben-Stab-Konstrukte in der opertiven Stabilisierung multisegmentaler 3-Säuleninstabilitäten – Eine biomechanische Analyse. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie” (ÖGNC), Feldkirch, Austria 10/2018
- S. Hartmann, A. Abramović, P.-P. Girod, M. Ortler, A. Tschugg, C. Thomé: Pre- and postoperative evaluation of the "Global Alignment and Proportion Score (GAP Score)" in pedicle subtraction osteotomies of the lumbar spine. “Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie” (ÖGNC), Feldkirch, Austria 10/2018
- S. Hartmann, R. Gmeiner, A. Tschugg, C. Thomé, W. Schmölz, H. Koller: Der Effekt diverser Schrauben-Stab Konfigurationen und multipler Schrauben-Stab-Konstrukte in der operativen Stabilisierung multisegmentaler 3-Säuleninstabilitäten – Eine biomechanische Analyse. „Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), Wiesbaden, Germany 12/2018
- S. Hartmann, A. Abramović, P.-P. Girod, M. Ortler, A. Tschugg, C. Thomé: Pre- and postoperative evaluation of the "Global Alignment and Proportion Score (GAP Score)" in pedicle subtraction osteotomies of the lumbar spine. “Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), Wiesbaden, Germany 12/2018
- P.-P. Girod, S. Hartmann, C. Thomé: Einfuss des Alters auf perioperative Komplikationen und Outcome von Pedikelsubtraktionsosteotomien (PSO) zur Korrektur der sagittalen Balance in adulten Deformitäten. „Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), Wiesbaden, Germany 12/2018
- S. Hartmann, A. Abramović, P.-P. Girod, M. Ortler, A. Tschugg, C. Thomé: Pre- and postoperative evaluation of the "Global Alignment and Proportion Score (GAP Score)" in pedicle subtraction osteotomies of the lumbar spine. “OEGCH Congress- Österreichische Gesellschaft für Chirurgie“ Innsbruck, Austria 06/2019
- A. Abramović, P.-P. Girod, A. Stocsits, S. Lener, C. Thomé, S. Hartmann: The efficiency of perioperative monitoring of hemoglobin and c-reactive protein for the postoperative emergence of a surgical site infection in pedicle subtraction osteotomies.“Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie- Section Meeting Spine” (DGNC), Gießen, Germany 09/2019
- A. Abramović, P.-P. Girod, A. Stocsits, S. Lener, C. Thomé, S. Hartmann: The efficiency of perioperative monitoring of hemoglobin and c-reactive protein for the postoperative emergence of a surgical site infection in pedicle subtraction osteotomies. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Vienna, Austria 10/2019
- A. Abramovic, P. P. Girod, A. Stocsits, S. Lener, A. Tschugg, C. Thomé, S. Hartmann: Korrelationsanalyse von CT-gemessener Knochenqualität und der Entstehung mechanischer Komplikationen bei Patienten nach lumbaler Spondylodese. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Vienna, Austria 10/2019
- S. Lener, P. P. Girod, S. Hartmann, M. Santer, C. Thomé: Selbstberichtete Patientenzufriedenheit nach PSO: Ein Erfahrungsbericht mit 74 Patienten. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Vienna, Austria 10/2019
- A. Stocsits, S. Lener, P.P. Girod, A. Abramovic, C. Thomé, S. Hartmann: Lumbale monostotische fibröse Dysplasie und ihr operatives Management – Ein Fallbericht. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Vienna, Austria 10/2019
- A. Stocsits, S. Hartmann, S. Fleck, R. Gerlac, J. Rathert, C.T., C. B. Lumenta, J. Landscheidt, C. Thomé: Klinisches und patienten-bezogenes Outcome nach zervikaler Arthroplastie: Zwischenergebnisse einer prospektiven multizentrischen Studie. „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC), Vienna, Austria 10/2019
- Abramović, P.-P. Girod, A. Stocsits, S. Lener, C. Thomé, S. Hartmann. The efficiency of perioperative monitoring of hemoglobin and c-reactive protein for the postoperative emergence of a surgical site infection in pedicle subtraction osteotomies. „Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), Munich, Germany 11/2019
- S. Lener, C. Wipplinger, A. Stocsits, A. Tschugg, C. Thomé, S. Hartmann. Pars interarticularis Schraube für die dorsale zervikale Fusion – Bewertung einer neuen Trajektorie unter Verwendung einer CT-basierten multiplanaren Rekonstruktion – Teil I. „Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), München, Deutschland, 11/2019
- S. Hartmann, S. Fleck (Greifswald), A. Stocsits, R. Gerlach, J. Rathert (Erfurt) C. T. Ulrich (Bern/Schweiz), C. B. Lumenta, J. Landscheidt (München), C. Thomé. Klinisches und patienten-bezogenes Outcome nach zervikaler Arthroplastie – Zwischenergebnisse einer prospektiven multizentrischen Studie. „Deutsche Wirbelsäulengesellschaft“ (DWG), München, Deutschland, 11/2019
Eingeladene Vorträge
- S. Hartmann: „Was bringen uns Bandscheibenprothesen an der HWS“. SpineUP, Regensburg, Germany 11/16
- S. Hartmann, C. Thomé: „Die A. vertebralis im Rahmen der Uncoforaminotomie“. Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie (ÖGNC), Sektionstagung vaskuläre Neurochirurgie, Innsbruck, Austria 11/16
- S. Hartmann: „Additive dorsale Stabilisierung bei zervikaler Multilevel Korporektomie: Biomechanische Grundlagen und Ergebnisse einer Multicenterumfrage“. Lunch Symposium AO Spine- Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie (ÖGNC), Vienna, Austria 10/2014
- S.Hartmann: „Revisionschirurgie versus Schmerzintervention nach erfolglosen Wirbelsäulenoperationen“. Wirbelsäulensymbosium Medtronic: BWS, lumbosakraler Übergang und Revision. Mondsee, Austria 06/2017
- S. Hartmann: „Morbus Bechterew und die aktuellen Behandlungsstrategien der ASDs“. Österreichische Wirbelsäulengesellschaft (ASS), Vienna, Austria 01/2017
- S. Hartmann: „Metastasen der Wirbelsäule“. Österreichische Wirbelsäulengesellschaft (ASS), Vienna, Austria 01/2018
- S. Hartmann: “Black Armor- Spinal Implants. See what you have never seen at the spine before”. Icotec Key Note EuroSpine, Barcelona, Spain 09/2018
- S. Hartmann: “Herausforderungen in der postoperativen Bildgebung bei Patienten mit lumbalen Stabilisierungsoperationen“, Fireside Discussion Icotec, „Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie“ (ÖGNC) Vienna, Austria 10/19
- S. Hartmann: “Trauma of the rigid spine: Pitfalls and complication avoidance”. Cervical Spine research Society. EUROSPINE, Vienna, Austria 10/20- Webinar
- S. Hartmann: “Basic instrumentation of the spine”. OMI Meeting Salzburg Schloss Arenberg Salzburg. 13.09.-17.9.2021
- S. Hartmann: “What is required to become a spine surgeon. (How to plan and secure your career as a spine surgeon. Top Tips on how to make it)” 16.2.22 AO Webinar
- S. Hartmann: “Basic instrumentation of the spine”. OMI Meeting Salzburg Schloss Arenberg Salzburg. 26.09.-30.9.2022
OP Kurse
- Faculty Depuy Synthes Spine “ACDF Basic Course” Solothurn, Slowenien Valdoltra Surgeons 18.- 19.10.18
- Faculty Depuy Synthes Spine “Flying Doctor”, Slowenien Valdoltra Surgeons 3.- 4.6.19
- Faculty Depuy Synthes Spine “MIS TLIF Training Academy” MIS TLIF Kurs Hamburg 16.-17.9.19
- Icotec Hospitationsbetreuung- OP Orthopädie Salzburg in Innsbruck 4.8.18
- Faculty ÖGNC Section Meeting Spine “Dorsale HWS” 7.9.19
- Faculty “Basic instrumentation techniques”, Cornwell University Salzburg 1.-2.10.19
- Faculty Depuy Synthes Spine “MIS Kurs- My Journey to MIS TLIF”, Headquarter Solothurn 28.-29.10.19
- Faculty Depuy Synthes- MIS TLIF - An Innsbruck Perspective. 06/2020
- Faculty Johnson & Johnson Ethicon- Iatrogenic dural closure 10/2020
- Faculty “Basic instrumentation techniques”, Cornwell University Salzburg 13.-15.9.21
- Faculty AO Spine Webinar “Notfälle und Degeneration in der Wirbelsäule“ April 2021
- Faculty AO Spine Seminar “Notfälle und Degeneration in der Wirbelsäule“, Salzburg 10.09.-11.09.21
- How to streamline MIS surgery? Unleash MIS in practice. EUROSPINE Wien, 6.8.10.21
- Microdisectomy for lumbar disc herniations: Tips and tricks. EUROSPINE Wien, 6.8.10.21
- Faculty AO Spine “Getting to the top of Spine surgery” 2.3.22 AO Webinar
- Faculty AO Spine “How to plan and secure your career as a spine surgeon. Top Tips on how to make it.” 16.2.22 AO Webinar
- Faculty AO Spine Seminar “Notfälle und Degeneration in der Wirbelsäule“, Salzburg 22.04.-23.04.22
- Faculty DepuySynthes “MIS TLIF Training Academy “Case based discussion: Degenerative Disc disease and patient selection” 7.-9.9.2022
- Faculty “Basic instrumentation techniques”, Cornwell University Salzburg 26.-30.9.22
- Thaler M, Hartmann S, Gstöttner M, Lechner R, Gabl M, Bach C (2013) Footprint mismatch in total cervical disc arthroplasty. Eur Spine J 22:759-65. 10.1007/s00586-012-2594-3
- Hartmann S, Hegewald AA, Tschugg A, Neururer S, Abenhardt M, Thomé C (2015) Analysis of a performance-based functional test in comparison with the visual analog scale for postoperative outcome assessment after lumbar spondylodesis. Eur Spine J 10.1007/s00586-015-4350-y
- Hartmann S, Thomé C, Keiler A, Fritsch H, Hegewald AA, Schmölz W (2015) Biomechanical testing of circumferential instrumentation after cervical multilevel corpectomy. Eur Spine J 24:2788-98. 10.1007/s00586-015-4167-8
- Tschugg A, Tschugg S, Hartmann S, Rhomberg P, Thomé C (2015) Far caudally migrated extraforaminal lumbosacral disc herniation treated by a microsurgical lateral extraforaminal transmuscular approach: Case report. J Neurosurg Spine :1-4. 10.3171/2015.7.SPINE15342
- Tschugg A, Löscher WN, Hartmann S, Neururer S, Wildauer M, Thomé C (2015) Gender influences radicular pain perception in patients with lumbar disc herniation. J Womens Health (Larchmt) 10.1089/jwh.2014.5108
- Hartmann S, Tschugg A, Kavakebi P, Thomé C (2016) Intradural synovial cyst of the atlantoaxial joint: A case report. Acta Neurochir (Wien) 158:1583-6. 10.1007/s00701-016-2829-x
- Hartmann S, Tschugg A, Obernauer J, Neururer S, Petr O, Thomé C (2016) Cervical corpectomies: Results of a survey and review of the literature on diagnosis, indications, and surgical technique. Acta Neurochir (Wien) 158:1859-67. 10.1007/s00701-016-2908-z
- Obernauer J, Landscheidt J, Hartmann S, Schubert GA, Thomé C, Lumenta C (2016) Cervical arthroplasty with ROTAIO® cervical disc prosthesis: First clinical and radiographic outcome analysis in a multicenter prospective trial. BMC Musculoskelet Disord 17:1110.1186/s12891-016-0880-7
- Tschugg A, Lener S, Hartmann S, Neururer S, Wildauer M, Thomé C, Löscher WN (2016) Improvement of sensory function after sequestrectomy for lumbar disc herniation: A prospective clinical study using quantitative sensory testing. Eur Spine J 25:3543-9. 10.1007/s00586-016-4770-3
- Tschugg A, Löscher WN, Lener S, Hartmann S, Wildauer M, Neururer S, Thomé C (2016) The value of quantitative sensory testing in spine research. Neurosurg Rev 10.1007/s10143-016-0798-4
- Kavakebi P, Girod PP, Hartmann S, Tschugg A, Thomé C (2017) Transoral vertebroplasty of the lateral mass of C1 using image guidance. Acta Neurochir (Wien) 10.1007/s00701-017-3158-4
- Hartmann S, Thomé C, Tschugg A, Paesold J, Kavakebi P, Schmölz W (2017) Cement-augmented screws in a cervical two-level corpectomy with anterior titanium mesh cage reconstruction: A biomechanical study. Eur Spine J 10.1007/s00586-017-4951-8
- Tschugg A, Hartmann S, Lener S, Rietzler A, Sabrina N, Thomé C (2017) Minimally invasive spine surgery in lumbar spondylodiscitis: A retrospective single-center analysis of 67 cases. Eur Spine J 10.1007/s00586-017-5180-x
- Tschugg A, Löscher WN, Lener S, Wildauer M, Hartmann S, Neururer S, Thomé C (2017) Gender differences after lumbar sequestrectomy: A prospective clinical trial using quantitative sensory testing. Eur Spine J 26:857-64. 10.1007/s00586-016-4891-8
- Hartmann S, Tschugg A, Wipplinger C, Thomé C (2017) Analysis of the literature on cervical spine fractures in ankylosing spinal disorders. Global Spine J 7:469-81. 10.1177/2192568217700108
- Girod PP, Hartmann S, Kavakebi P, Obernauer J, Verius M, Thomé C (2017) Asymmetric pedicle subtractionosteotomy (apso) guided by a 3d-printed model to correct a combined fixed sagittal and coronal imbalance. Neurosurg Rev 10.1007/s10143-017-0882-4
- Hartmann S, Wipplinger C, Tschugg A, Kavakebi P, Örley A, Girod PP, Thomé C (2017) Thoracic corpectomy for neoplastic vertebral bodies using a navigated lateral extracavitary approach-a single-center consecutive case series: Technique and analysis. Neurosurg Rev 10.1007/s10143-017-0895-z
- Tschugg A, Lener S, Hartmann S, Wildauer M, Löscher WN, Neururer S, Thomé C (2017) Preoperative sport improves the outcome of lumbar disc surgery: A prospective monocentric cohort study. Neurosurg Rev 10.1007/s10143-017-0811-6
- Hartmann S, Kavakebi P, Wipplinger C, Tschugg A, Girod PP, Lener S, Thomé C (2017) Retrospective analysis of cervical corpectomies: Implant-related complications of one- and two-level corpectomies in 45 patients. Neurosurg Rev 10.1007/s10143-017-0854-8
- Tschugg A, Lener S, Hartmann S, Rietzler A, Neururer S, Thomé C (2017) Primary acquired spondylodiscitis shows a more severe course than spondylodiscitis following spine surgery: A single-center retrospective study of 159 cases. Neurosurg Rev 10.1007/s10143-017-0829-9
- Unterhofer C, Hartmann S, Freyschlag CF, Thomé C, Ortler M (2017) Severe head injury in very old patients: To treat or not to treat? Results of an online questionnaire for neurosurgeons. Neurosurg Rev 10.1007/s10143-017-0833-0
- Mern DS, Tschugg A, Hartmann S, Thomé C (2017) Self-complementary adeno-associated virus serotype 6 mediated knockdown of ADAMTS4 induces long-term and effective enhancement of aggrecan in degenerative human nucleus pulposus cells: A new therapeutic approach for intervertebral disc disorders. PLoS One 12:e017218110.1371/journal.pone.0172181
- Petr O, Glodny B, Brawanski K, Kerschbaumer J, Freyschlag C, Pinggera D, Hartmann S, Thomé C (2017) Immediate versus delayed surgical treatment of lumbar disc herniation for acute motor deficits: The impact of surgical timing on functional outcome. Spine (Phila Pa 1976) 10.1097/BRS.0000000000002295
- Ryabykh SO, Pavlova OM, Savin DM, Khomchenkov MV, Ochirova PV, Hartmann S, Gubin AV (2017) Malpositioned pedicle screw compressed thoracic aorta of a patient with adolescent idiopathic scoliosis: Case report and literature review. Techniques in Orthopaedics Publish Ahead of Print10.1097/BTO.0000000000000240
- Lener S, Wipplinger C, Hartmann S, Löscher WN, Neururer S, Wildauer M, Thomé C, Tschugg A (2017) The influence of surface emg-triggered multichannel electrical stimulation on sensomotoric recovery in patients with lumbar disc herniation: Study protocol for a randomized controlled trial (RECO). Trials 18(1):56610.1186/s13063-017-2310-z
- Hegewald AA, Hartmann S, Keiler A, Scheufler KM, Thomé C, Schmoelz W (2017) Biomechanical investigation of lumbar hybrid stabilization in two-level posterior instrumentation. Eur Spine J 10.1007/s00586-017-5415-x
- Lener S, Hartmann S, Barbagallo GMV, Certo F, Thomé C, Tschugg A (2018) Management of spinal infection: A review of the literature. Acta Neurochir (Wien) 10.1007/s00701-018-3467-2
- Tschugg A, Kavakebi P, Hartmann S, Lener S, Wipplinger C, Löscher WN, et al (2018) Clinical and radiological effect of medialized cortical bone trajectory for lumbar pedicle screw fixation in patients with degenerative lumbar spondylolisthesis: Study protocol for a randomized controlled trial (mpact). Trials 19:12910.1186/s13063-018-2504-z
- Koller H, Hartmann S (2018) [Fixed cervical high-grade kyphosis : Chin-on-chest deformity-treatment plan]. Orthopade 47:505-17. 10.1007/s00132-018-3564-1
- Tschugg A, Lener S, Hartmann S, Fink V, Neururer S, Wildauer M, et al (2018) Extraforaminal lumbar disc herniations lead to neuroplastic changes: A study using quantitative sensory testing. Muscle Nerve 10.1002/mus.26184
- Tschugg A, Kavakebi P, Hartmann S, Lener S, Wipplinger C, Löscher WN, et al (2018) Clinical and radiological effect of medialized cortical bone trajectory for lumbar pedicle screw fixation in patients with degenerative lumbar spondylolisthesis: Study protocol for a randomized controlled trial (mpact). Trials 19:12910.1186/s13063-018-2504-z
- Hartmann S, Kavakebi P, Tschugg A, Lener S, Stocsits A, Thomé C (2019) Navigation for tubular decompression of the L5 nerve root ganglion after cement leakage via a wiltse approach. Asian J Neurosurg 14:565-7. 10.4103/ajns.AJNS_253_18
- Lener S, Wipplinger C, Hartmann S, Thomé C, Tschugg A (2019) The impact of obesity and smoking on young individuals suffering from lumbar disc herniation: A retrospective analysis of 97 cases. Neurosurg Rev 10.1007/s10143-019-01151-y
- Kögl N, Dostal M, Örley A, Thome C, Hartmann S (2020) Traction screws to reduce a bilateral pedicle fracture of L5: a case report. Journal of neurosurgery. Spine 10.3171/2020.1.SPINE191229
- Hartmann S, Thomé C, Abramovic A, Lener S, Schmoelz W, Koller J, Koller H (2020) The effect of rod pattern, outrigger, and multiple screw-rod constructs for surgical stabilization of the 3-column destabilized cervical spine - A biomechanical analysis and introduction of a novel technique. Neurospine 1710.14245/ns.2040436.218
- Lener S, Wipplinger C, Hartmann S, Rietzler A, Thomé C, Tschugg A (2020) Gender-Specific differences in presentation and management of spinal infection: A single-center retrospective study of 159 cases. Global Spine J 10.1177/2192568220905804
- Stocsits A, Lener S, Girod PP, Abramovič A, Thomé C, Hartmann S (2020) Kyphotic deformity of the lumbar spine due to a monostotic fibrous dysplasia of the second lumbar vertebra: A case report and its surgical management. Acta Neurochir (Wien) 16210.1007/s00701-020-04531-2
- Lener S, Wipplinger C, Stocsits A, Hartmann S, Hofer A, Thomé C (2020) Early surgery may lower mortality in patients suffering from severe spinal infection. Acta Neurochir (Wien) 16210.1007/s00701-020-04507-2
- Meyer B, Wagner A, Grassner L, Kögl N, Hartmann S, Thomé C, Wostrack M (2020) Chiari malformation type I and basilar invagination originating from atlantoaxial instability: A literature review and critical analysis. Acta Neurochir (Wien) 16210.1007/s00701-020-04557-6
- Wagner A, Grassner L, Kögl N, Hartmann S, Thomé C, Wostrack M, Meyer B (2020) Chiari malformation type I and basilar invagination originating from atlantoaxial instability: A literature review and critical analysis. Acta Neurochir (Wien) 16210.1007/s00701-020-04429-z
- Abramovic A, Demez M, Krigers A, Bauer M, Lener S, Pinggera D, Kerschbaumer J, Hartmann S, Fritsch H, Thomé C, Freyschlag CF. Surgeon’s comfort: the ergonomics of a robotic exoscope using a head-mounted display. Brain & Spine. In press
- Abramovic A, Lener S, Grassner L, Thaler M, Pinggera D, Freyschlag CF, Thomé C, Hartmann S, The impact of the COVID-19 pandemic on spine surgery in central Europe: A questionnaire-based study, World Neurosurgery (2021)
- Koller H, Hartmann S, Gmeiner R, Schmölz W, Orban C, Thome C. Surgical nuances and construct patterns influence construct stiffness in C1-2 stabilizations: a biomechanical study of C1-2 gapping and advanced C1-2 fixation. Eur Spine J. 2021 Jun;30(6):1596-1606. doi: 10.1007/s00586-021-06822-3.
- Pinggera D, Kerschbaumer J, Grassner L, Demnetz M, Hartmann S, Thomé C. Effect of the COVID-19 Pandemic on Patient Presentation and Perception to a Neurosurgical Outpatient Clinic. Neurosurg 2021 May;149:e274-e280. doi: 10.1016/j.wneu.2021.02.037. Epub 2021 Feb 18.
- Lener S, Wippling C, Lang A, Hartmann S, Abramovic A, Thomé C. A scoring system for the preoperative evaluation of prognosis in spinal infection: the MSI-20 score. pine J. 2021 Dec 24;S1529-9430(21)01094-9. doi: 10.1016/j.spinee.2021.12.015.Online ahead of print.
- Girod PP, Kögl N, Granit M, Lener S, Hartmann S, Thomé C. Flexing a standard hinge-powered operating table for lumbosacral three-column osteotomy (3-CO) site closure in 84 consecutive patients Neurosurg Rev. 2022 Feb;45(1):517-524. doi: 10.1007/s10143-021-01559-5. Epub 2021 May 8.
- Fleck S, Lang A, Lehmberg J, Landscheidt JF, Gerlach R, Rathert J, Ulrich C, Schär RT, Hartmann S, Mueller JU, Thomé C. Prospective Multicenter Trial of Cervical Arthroplasty with the ROTAIO® Cervical Disc Prosthesis. Global Spine J. 2022Aug 5;21925682221109563. doi: 10.1177/21925682221109563.
- Lener S, Hartmann S, Thomé C. Reply to the letter to editor regarding, "A scoring system for the preoperative evaluation of prognosis in spinal infection: the MSI-20 score". Spine J. 2022 Aug;22(8):1419-1420. doi: 10.1016/j.spinee.2022.04.017
- Hartmann S, Lang A, Lener S, Abramovic A, Grassner L, Thomé C Minimally invasive versus open transforaminal lumbar interbody fusion: a prospective, controlled observational study of short-term outcome. Neurosurg Rev. 2022 Oct;45(5):3417-3426. doi: 10.1007/s10143-022-01845-w. Epub 2022 Sep 6
- Grassner L, Garcia-Ovejero D, Mach O, Lopez-Dolado E, Vargas-Baquero E, Alcobendas-Maestro M, Esclarin A, Sanktjohaneser L, Wutte C, Becker J, Lener S, Hartmann S, Girod PP, Kögl N, Griessenauer CJ, Papadopoulus M, Geisler F, Thome C, Molina-Holgado E, Vidal J, Curt A, Scivoletto G, Guest J, Maier D, Weidner N, Rupp R, Kramer JLK, Arevalo-Martin A. A New Score Based on the International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury for Integrative Evaluation of Changes in Sensorimotor Functions. J Neurotrauma. 2022 May;39(9-10):613-626. doi: 10.1089/neu.2021.0368.
- Gasser L, Lener S, Hartmann S, Löscher WN, Thomé C, Hofer A. Does preoperative opioid therapy in patients with a single lumbar disc herniation positively influence the postoperative outcome detected by quantitative sensory testing? Neurosurg Rev. 2022 Aug;45(4):2941-2949. doi: 10.1007/s10143-022-01818-z. Epub 2022 May
Dr. Michael Spiegel
Dr. Michael Spiegel absolvierte seine Ausbildung zum Facharzt für Neurologie an der Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck, wo er von 2005 bis 2010 auch als Oberarzt tätig war. Seit 2010 ist er mit einer eigenen Facharztpraxis am Sanatorium Kettenbrücke tätig.
Dr. Susanne Bellinger
Dr. Susanne Bellinger absolvierte ihre Ausbildung zur Fachärztin für Neurologie an der Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck und am Landeskrankenhaus Hochzirl. 2012 bis 2013 war sie Teil eines internationalen Forschungsteams für IOM – Intraoperative Monitoring am Hospital for Joint Diseases in New York. Seit 2017 ist mit einer eigenen Facharztpraxis am Sanatorium Kettenbrücke tätig.
Dr. Michael Nocker
Dr. Michael Nocker absolvierte seine Ausbildung zum Facharzt für Neurologie an der Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck, wo er von 2008 bis 2015 auch als Assistenzarzt und von 2015 bis 2019 als Oberarzt tätig war. Er ist Co-Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und wirkte an mehreren wissenschaftlichen Studien, u.a. zu Parkinson, Dystonie und Morbus Huntington, mit.
Ärzte

Dr. Susanne Bellinger
Neurologie,
Wirbelsäulenzentrum
Sennstraße 1
6020 Innsbruck
Tel. +43 512 2112 831
Fax +43 512 2112 710
susanne.bellinger@sanatorium-kettenbruecke.at
www.die-neurologen.at

Dr. Michael Gabl
Neurochirurgie,
Wirbelsäulenzentrum
, Neurochirurgische Intensivmedizin
Sennstraße 1
6020 Innsbruck
Tel. +43 512 2112 700
Fax +43 512 2112 713
michael.gabl@sanatorium-kettenbruecke.at
www.wik-innsbruck.at
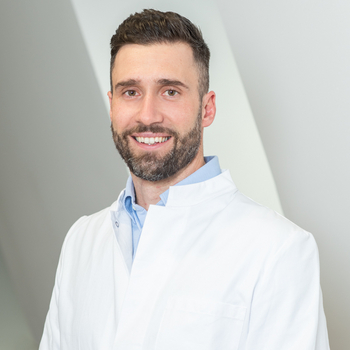
Priv.-Doz. Dr. Sebastian Hartmann, PhD
Neurochirurgie,
Wirbelsäulenzentrum
Sennstraße 1
6020 Innsbruck
Tel. +43 512 2112 700
Fax +43 512 2112 713
sebastian.hartmann@sanatorium-kettenbruecke.at
www.wik-innsbruck.at

Dr. Pujan Kavakebi
Neurochirurgie,
Wirbelsäulenzentrum
Sennstraße 1
6020 Innsbruck
Tel. +435122112 700
Fax +435122112 713
pujan.kavakebi@sanatorium-kettenbruecke.at
www.wik-innsbruck.at

Dr. Michael Koller
Neurochirurgie,
Wirbelsäulenzentrum
Sennstraße 1
6020 Innsbruck
Tel. +43 512 2112 700
Fax +43 512 2112 713
michael.koller@sanatorium-kettenbruecke.at
www.wik-innsbruck.at

Dr. Michael Nocker
Neurologie,
Wirbelsäulenzentrum
Sennstraße 1
6020 Innsbruck
Tel. +43 512 2112 831
Fax +43 512 2112 710
michael.nocker@sanatorium-kettenbruecke.at
www.die-neurologen.at

Dr. Jochen Obernauer
Neurochirurgie,
Wirbelsäulenzentrum
Sennstraße 1
6020 Innsbruck
Tel. +43 512 2112 700
Fax +43 512 2112 713
jochen.obernauer@sanatorium-kettenbruecke.at
www.wik-innsbruck.at
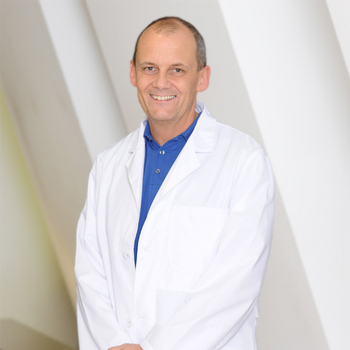
Dr. Michael Spiegel
Neurologie,
Wirbelsäulenzentrum
Sennstraße 1
6020 Innsbruck
Tel. +43 512 2112 831
Fax +43 512 2112 710
michael.spiegel@sanatorium-kettenbruecke.at
www.die-neurologen.at
